Ein neuer Speicherteich oder lieber die Solaranlage auf dem Dach? Poa-Grüns oder doch eine Festuca-Mischung? Ein E-Bus für die Mannschaften oder ein Diesel-Modell? Und was passiert eigentlich mit den Wasserflaschen aus Plastik beim Ligaspiel?
Die Fragen, die sich derzeit vor deutschen Golfanlagen angesichts der Herausforderungen des Klimawandels auftürmen, sind vielfältig. Dazu kommen kritische Kommentare von Medien und Behörden, wenn es um den Wasser- und Landverbrauch geht und der ständige Konkurrenzkampf mit anderen Golfanlagen um Mitglieder und die Generierung von Einnahmen.
Kurzum: Die Branche ist unter Druck. Die öffentliche Mahnung mehr Verantwortung für Klima und Umwelt zu übernehmen ist immanent. Und ein Blick auf den aktuellen Weltklimabericht des IPCC zeigt: Die Krisen, die durch Wetterextreme wie Hitze, Dürre, Stürme oder Überschwemmungen verursacht werden, nehmen zu.
Als Outdoorsportart, die auf rein natürlichem Gelände stattfindet, ist der Golfsport davon in besonderem Maße betroffen: Alle Wetterextreme stören die Pflege des Golfplatzes, machen sie teurer und führen bei fehlender Resilienz des Golfplatzes zu sinkender Qualität. Gleichzeitig können wirtschaftliche Einbußen durch fehlende Mitglieder und Greenfeespieler sowie abwandernde Sponsoren entstehen, die sich wetterbeständigen Sportarten zuwenden.
Wie also sieht die Zukunft des Golfsports in Deutschland aus?
Deutschlands Golfanlagen können viel zu einer positiven Anpassung des Landes an den Klimawandel beitragen: Sie können Biodiversität und Artenvielfalt fördern und dienen in Zeiten des Klimawandels mit ihren großen Naturflächen als Auffangbecken bei Stark-Regenfällen in urbanen Gebieten, um Überschwemmungen zu vermeiden. Sie verhindern die Versiegelung von Flächen, sind regionale grüne Lungen und kühlen Landschaftsgebiete bei hohen Temperaturen. Gleichzeitig schaffen sie ein Bewegungsangebot für alle Altersgruppen und punkten auch mit inklusiven Angeboten.
Trotzdem stehen Golfanlagen zunehmend im Fokus von Klimaschutz- und Umweltdiskussionen. Zu Recht. Denn noch immer werden zum Beispiel etliche Anlagen mit Trinkwasser bewässert und oftmals zu viele Pestizide und Düngemittel für den perfekten Pflegezustand der genutzten Grünflächen verwendet. Auch die Schaffung einer Außendarstellung als offene Sportart, die für alle Bevölkerungsteile Mehrwerte schaffen will, ist noch nicht gelungen.
Ganzheitliche Nachhaltigkeit als Leitprinzip
Zur Existenzsicherung des Golfanlagenbetriebs in Deutschland wird es essenziell notwendig sein, Nachhaltigkeit nicht als Einzelmaßnahme, sondern als integralen Bestandteil der Betriebsführung und des Geschäftsmodells zu verstehen.
Ein möglicher Lösungsansatz erfordert die ganzheitliche Transformation der Anlagen auf einem Zeitstrahl von heute bis 2050, der Energie- und Wasserverbrauch tiefgreifend reduziert, ökologische Pflegekonzepte etabliert, Ressourcen nachhaltig managt und Golfanlagen als wertvollen Bestandteil der Gemeinschaft etabliert. Nur durch eine konsequente Umsetzung dieser Maßnahmen können Golfplätze zukünftig klimaneutral, wasserautark, umwelt- und sozialverträglich betrieben werden.
Ökologische Pflege und Artenvielfalt fördern
Neben Energie und Wasserbedarf verlangt die ökologische Verantwortlichkeit vor allem Veränderungen im Platzmanagement. Der Einsatz von Pestiziden muss auf den Notfall beschränkt werden , der Einsatz von Düngemitteln deutlich reduziert werden. Nachhaltige, umweltschonende Methoden haben Vorrang. Golfanlagen sollen als grüne Inseln in der Kulturlandschaft fungieren, die einen geschützten Lebensraum für Artenvielfalt von Fauna und Flora bietet. So wird zum Beispiel durch die Anlage von Blühstreifen, Hecken und naturnahen Gewässern die Biodiversität gestärkt. Eine ökologische Pflege trägt auch zum Bodenschutz bei – was wiederum positive Effekte auf Wasserhaushalt und Klima hat.
Energie- und Wassermanagement konsequent umgestalten
Ein entscheidender Hebel liegt im Umstieg auf erneuerbare Energien und der drastischen Reduktion von CO₂-Emissionen. Als Freizeitindustrie übernimmt die deutsche Golfbranche Verantwortung und schließt sich den nationalen Klimazielen, die Klimaneutralität Deutschlands im Jahr 2045 vorgeben, an. Als Empfehlung sollten Golfanlagen sukzessive versuchen ihren Energiebedarf bis 2025 zu 100% aus regenerativen Quellen zu decken und dabei auf Photovoltaik, Speicher und elektrische Maschinen setzen.
Parallel dazu gilt es, den Wasserverbrauch radikal zu senken. Die Nutzung von Trink- und Grundwasser wird zunehmend reguliert, deshalb müssen effiziente Systeme zur Nutzung von Regen- und Grauwasser installiert sowie intelligente Bewässerungstechniken umgesetzt und – soweit sinnvoll – und möglich, Speicherteiche und weitere Speichermedien genutzt werden. Dies schützt kostbare Ressourcen und verringert betrieblich bedingte Umwelt- und langfristige Kostenbelastungen erheblich.
Ressourcen- und Abfallmanagement neu denken
Ein weiterer wichtiger Bereich, derzeit noch kaum im Blick vieler Golfanlagen, ist die Reduktion von Plastik- und Abfallproduktion. Golfbetriebe sollten konsequent auf Einwegplastik verzichten und verstärkt auf biologisch abbaubare sowie Mehrwegprodukte setzen. Dies betrifft den Einkauf für Gastronomie, Proshop und Verwaltung genauso wie die Kommunikation an den Golfer selbst, der mit der Thematik des Recycling und vor allem der Müllvermeidung kontinuierlich vertraut gemacht werden muss.
Das Prinzip der Kreislaufwirtschaft und der Vorrang des lokalen oder regionalen Einkaufs sollte implementiert werden, um an dieser Stelle positiven Einfluss auf die CO2-Emissionen der Golfanlage zu nehmen. Ein umfassendes Einkaufs-, Recycling- und Ressourceneffizienz-Konzept unterstützt die ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit.
Mitglieder und Öffentlichkeit informieren und beteiligen
Die zukunftsgerichtete Transformation der Golfanlage gelingt nur durch Transparenz gegenüber Golfern und anderen Mitgliedern der Gesellschaft. Die kontinuierliche Kommunikation der Prozesse räumt mit Vorurteilen und falschen Informationen auf, schafft einerseits Vertrauen und motiviert andererseits neue Unterstützer. So können Golfanlagen ihr Umweltprofil schärfen, das Vertrauen von Mitgliedern und breiter Öffentlichkeit stärken und neue Golfer durch eine positive Außendarstellung gewinnen.
Wie kann das gelingen? Wie wird es finanziert?
Das Anforderungsprofil an eine resiliente und zukunftsorientierte Golfanlage ist hoch. Viele Verantwortliche schrecken vor der Frage der Investitionen zurück. Die gute Nachricht aber ist: Es gibt sehr gute Best-Practice-Beispiele aus Deutschland, aber auch aus Dänemark, Holland, Frankreich, England oder Italien, die diese Transformation bereits erfolgreich abgeschlossen oder begonnen haben. Sie eint die Erfahrung, dass der Prozess auch wirtschaftlich nachhaltig ist und die Attraktivität der Golfanlage steigert.
Folgende Instrumente können zur Unterstützung genutzt werden:
- Förderprogramme von Bund, Ländern und EU bestehen bereits jetzt und werden – zum Beispiel bei der Anschaffung von Wetterstationen, elektrischen Mährobotern oder dem Bau von Speicherteichen – von Golfanlagen genutzt.
- Kooperationen mit Behörden oder großen Naturschutzverbänden sorgen für mehr Expertise und Hilfe bei der Umsetzung von Maßnahmen auch durch Personal.
- Die Umstellung auf erneuerbare Energien und generell geringeren Ressourcenverbrauch in allen Bereichen der Golfanlage sorgt für sofortige und langfristige Einsparungen beim Verbrauch. Dies gilt auch für Kosten, die durch die steigende Bepreisung von CO2-Emissionen, zunehmend auflaufen werden.
- Die Implementierung eines Nachhaltigkeitsbeauftragten im Club sorgt für die konsequente Einbindung nachhaltiger Prozesse von Beginn an und verhindert überflüssige und womöglich doppelte Ausgaben.
- Eine nachhaltig geführte Anlage ist attraktiv für Sponsoren und neue Golfer und kann mehr Einnahmen generieren.
INSERT_STEADY_NEWSLETTER_SIGNUP_HERE
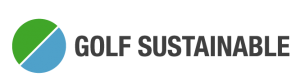


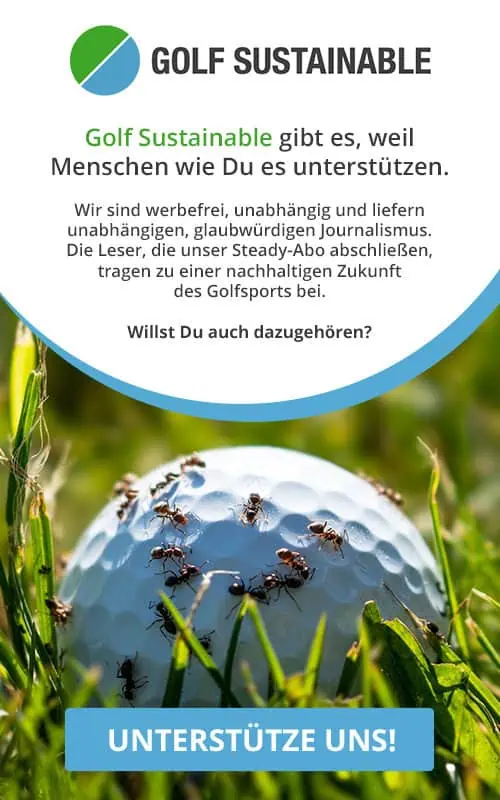




 Foto: Turfrad
Foto: Turfrad