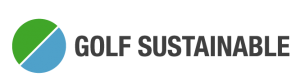Biodiversitäts-Lexikon: L wie Lupine
Lupinen (Lupinus) sind ein Blickfänger: Bunt, schön anzuschauen und deshalb im Umfeld von Golfanlagen immer wieder zu sehen. Lupinen weisen einen bemerkenswerten Lotuseffekt auf: Ihre fein behaarten Blätter sammeln Wassertropfen, speichern sie aber gleichzeitig so, dass die Blätter nicht umknicken – eine Anpassung, die bei Regen die Pflanzenstruktur erhält. Dabei sind die robusten Schmetterlingsblütler, die man als Zierpflanzen oder Wildpflanzen auch in Hausgärten oder freien Natur sieht, aber eine Pflanze, die Experten mit gemischten Gefühlen betrachten, weil sie einerseits eine positive ökologische Bedeutung hat, andererseits zum Beispiel in der Schweiz und Deutschland aber auch als invasive Art gilt.
Lupinen spielen eine Schlüsselrolle als Stickstoffsammler: Sie bilden in Symbiose mit Knöllchenbakterien (z. B. Rhizobium) in ihren Wurzeln Stickstoff aus der Luft um und reichern ihn im Boden an – ein bedeutender Nutzen sowohl für die Lupine selbst als auch für benachbarte Pflanzenarten. Als Pionierpflanzen besiedeln sie oft gestörte oder nährstoffarme Standorte − etwa Böschungen, Lichtungen oder Böden entlang von Wegen − und fördern so die Sukzession, also die natürliche Entwicklung von Vegetationsstrukturen.
INSERT_STEADY_NEWSLETTER_SIGNUP_HERE
Die Vielblättrige Lupine gilt in Deutschland und der Schweiz aber als invasive Art. Sie überwuchert oft standorttypische Vegetation, verdrängt einheimische Arten und kann dadurch die lokale Biodiversität beeinträchtigen. Während man sie außerhalb von Golfplätzen insbesondere an Straßen- und Bahnböschungen oder Waldrändern findet, sieht man sie auf Golfanlagen in Roughbereichen. Aufgrund ihrer attraktiven Blüte wird sie dort oftmals stehen gelassen. Genau das Gegenteil empfehlen Biodiversitäts-Experten aber: Wenn sich Lupinen auf dem Golfplatz entwickeln, sollten sie als invasive Art betrachtet und vom Greenkeeping Team entfernt werden.