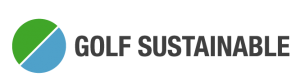First Green heißt das Programm, das dabei helfen soll zwei Probleme des Golfsports in den USA zumindest teilweise zu beheben: Zum einen den Arbeitskräftemangel im Greenkeeping. Zum Zweiten die oftmals falsche Außenwahrnehmung von Golfplätzen bei Nicht-Golfern. Seit 1997 betreibt die GCSAA, der amerikanische Greenkeeperverband, deshalb ein Programm, das den Schulunterricht in naturwissenschaftlichen Fächern auf den Golfplatz holt. Was auf den ersten Blick als einfache Übung erscheint, ist in der Praxis durchaus mit Herausforderungen verbunden.
„Der erste Gedanke von Lehrern, die selbst nicht Golf spielen, ist oft: Ich kann das nicht machen“, erinnert sich der CEO der GCSAA, Rhett Evans, an die Anfänge. Fragen der finanziellen Förderung zum Beispiel für die benötigten Busse zur Anfahrt zum Golfclub tauchen auf, aber auch kritische Punkte wie Sicherheit oder die Verwendung von Chemie auf den Golfplätzen. „Es gibt durchaus Menschen, die denken, es sei nicht sicher einen Golfplatz zu betreten, weil er voller Chemikalien stecke.“
Meinungsumschwung auf dem Golfplatz
Evans hat zu diesem Punkt auch eine persönliche Anekdote parat: Als er einen der ersten First-Green-Ausflüge persönlich begleitete und nicht als GCSAA-CEO erkennbar war, unterhielten sich die Eltern der Kindern ungeniert über ihre Bedenken. Ich habe Sachen gehört wie: „Ich bin hier draußen, um mir Notizen zu machen und mich dann beim Schuldirektor zu beschweren, unsere Kinder sollten nicht hier draußen sein.“ Als die Kinder dann aber die ersten Wassertests auf der Golfanlage gemacht hatte und das Wasser sauberer war als jenes, das aus dem Wasserhahn lief, verstummten die Eltern. „Dann haben sie die Schmetterlinge bemerkt, die Bienen und die Hasen. Und ziemlich schnell haben sie ihre Meinung geändert.“ Seitdem ist für Evans klar: „Das Schwierigste ist es, die Leute überhaupt auf den Golfplatz zu bringen.“
Im Rahmen des First Green Programmes werden Schulfächer auf dem Golfplatz unterrichtet. Der Wassertest zum Beispiel vermittelt Kenntnisse in Chemie. Auf den Wiesen, den Biotopen oder bei den Bienenstöcken sind Biologie-Einheiten möglich. Im Pinehurst Golf Resort war eine Schulklasse zwei Wochen vor der letzten U.S. Open zu Gast. Bei der Pflanzung regionaler Gräser wurde deren Bedeutung für das Thema Artenvielfalt diskutiert. Anschließend ging es an die Datenerhebung auf dem Puttinggrün. Elf Tage vor dem Major-Turnier wurden Grüngeschwindigkeit, Konstanz und Festigkeit gemessen. Außerdem wurde der Feuchtigkeitsgehalt im Gras bestimmt. Und zum Schluss konnten die Kinder im Rahmen eines Kunstprojektes auch noch ihre Vorstellungen von einem umgebauten Golfloch zu Papier bringen.
STEAM-Unterricht der GCSAA hat inzwischen selbst an den entferntesten Flecken der Welt stattgefunden. 2024 nahm Muhammad Ali, Head-Greenkeeper auf dem William Land Golf Course in Sacramento, Kalifornien, 15 Schüler zum Karachi Golf Club mit, um dort anhand von fünf Stationen Unterricht auf dem Golfplatz durchzuführen.
INSERT_STEADY_NEWSLETTER_SIGNUP_HERE
Finanziert wird das Programm über die Stiftung der GCSAA, deren Start 1997 durch Spenden in Millionenhöhe möglich gemacht wurden. Aufgesetzt ist das gesamte Programm im “Train the Trainers-Stil”. Die GCSAA schult die Superintendents und erklärt ihnen in Form von Vorträgen oder durch Schulungsmaterial, wie sie einen STEAM-Tag am besten durchführen. Die Nachfrage von Seiten der Greenkeeper ist laut Evans hoch. “Superintendents werden ja häufig unterschätzt“, erklärt Evans. „Die meisten Menschen denken, sie mähen nur Gras. „Sie geraten durch das Programm in ein völlig neues Licht und werden anders betrachtet.“ Deshalb, so die Meinung des GCSAA-CEO, werde das Programm auch wirklich gut angenommen.
2025 haben bis dato bereits 98 Exkursionen mit 6.676 Schülern stattgefunden. Seit 2018 kommt die GCSAA Foundation auf 401 Exkursionen mit 24.675 Schülern in immerhin 47 verschiedenen Bundesstaaten oder in Kanada sowie anderen Ländern.
Eine Herausforderung bleibt: Um tatsächlich auch die Attraktivität des Greenkeeper-Jobs an die passende Altersklasse zu vermitteln, machen die STEAM-Ausflüge vor allem für jene Jugendliche Sinn, die sich im letzten High-School-Jahr befinden. Dort aber findet der Unterricht stets sehr aufgesplittet in einzelne Stunden und Klassen statt. Hier wird die Organisation der Ausflüge deutlich schwieriger, weil mehrere Lehrer betroffen sind.
„Wir müssen uns auf die letzte Klasse fokussieren, weil sich die Schüler dort Gedanken darüber machen, was sie nach ihrer Schulzeit tun“, ist sich Evan sicher. „Wenn wir sie an dem Punkt erwischen und ihnen eine erstklassige Erfahrung liefern, steigen unsere Chancen, sie für einen Job auf den Golfplatz zu gewinnen.“
Dabei spielt es keine Rolle, ob der Unterricht auf einer preisgünstigen öffentlichen Anlage oder in einem teuren Privatclub stattfindet. Gleiches gilt für die Schulen: Mal kommen Kinder aus einer öffentlichen Schule mitten im Stadtzentrum, mal Kinder einer katholischen Privatschule auf dem Land.
Die Botschaft bleibt an jedem Ort und für jede Zielgruppe die gleiche: Der Golfplatz als Arbeitsplatz ist attraktiv, weil er fächerübergreifende Tätigkeiten möglich macht. Dass es obendrein ein Golfplatz in einer natürlichen Umgebung ist, macht das Angebot noch besser.