Rough-Säume auf Golfanlagen sichern im Winter den Lebensraum von Insekten, auch wenn der erste Gedanke beim Blick auf den Saum verblühter Wiesenhalme, die da am Fairwayrand stehen, ein anderer ist: Hier hat das Greenkeeping-Team den Schnitt vergessen; da war der Mäher kaputt oder der Arbeitstag womöglich zu Ende. Schließlich ist der Rest des Roughs perfekt gemäht. Unordnung also, und das kurz vor dem Winter.
Die scheinbare Unordnung macht in diesem Fall Sinn, wenn es um die Förderung der Biodiversität auf Golfanlagen geht. Während über Jahrzehnte im Spätsommer und Herbst alle Wiesen gleichmäßig abgemäht wurden, hat sich inzwischen auf zahlreichen Golfanlagen die sogenannte Streifenmahd durchgesetzt. Dabei werden jeweils Teile der Wiese stehengelassen, um für Insekten und Tiere einen Rückzugsort zu bieten.
Insekten brauchen Platz zum Verstecken, Eingraben und Einwickeln, um über die kalte Jahreszeit zu kommen. Auf- und ausgeräumte Flächen sind für sie eine Katastrophe. Ein bisschen Unordnung sichert Libellen und Käfern, Faltern und Raupen das Überleben. Sie alle haben sich womöglich einen Golfplatz als Lebensraum ausgesucht und wollen dort auch überwintern. Werden alle Wiesen heruntergemäht, alle Wasserflächen von Pflanzenstengeln freigeräumt und womöglich auch noch die Totholzhaufen entfernt, schwinden die Winterquartiere von Insekten.
Die Devise ist deshalb klar: Etwa zehn bis 20 Prozent einer Fläche sollten jeweils nicht abgemäht werden, wobei dieser Bereich idealerweise in jedem Jahr geändert wird. Damit lässt man den Pflanzen übrigens auch die Gelegenheit ihre Samen zu verteilen, wenn es sich um spät blühende Arten handelt.
INSERT_STEADY_NEWSLETTER_SIGNUP_HERE
Grasschnitt darf nicht liegen bleiben
Auch bei der Mahd selbst gehen Greenkeeper inzwischen neue Wege. Die einfache Methode, den Grasschnitt auf der gemähten Wiesenfläche liegenzulassen, ist völlig überholt. Das sogenannte Mulchen, so nennt man das Liegenlassen des Schnittguts, hat fast ausschließlich negative Folgen.
Weniger Vielfalt: Beim Mulchen wird das Mähgut auf der Fläche verteilt, wodurch Licht den Boden nicht mehr erreicht. Das behindert weniger konkurrenzstarke Pflanzen und Keimlinge, die auf offene Bodenstellen angewiesen sind. Wildblumen und Kräuter verschwinden allmählich.
Überdüngung des Bodens: Die Zersetzung des Mulchs reichert den Boden mit Nährstoffen an, was nährstoffliebende, dominante Gräser fördert. Seltenere Pflanzenarten haben so keine Chance und die Wiesen verarmen.
Verlust von Lebensräumen: Mulchen zerstört Lebensräume für Insekten, Spinnen, Amphibien und bodenbrütende Vögel, die ungestörte Wiesen benötigen. Das Mulchmaterial blockiert Verstecke und Nahrungsquellen.
Gefährdete Insektenpopulationen: Bestäuber wie Bienen, Schmetterlinge und Käfer verlieren durch das Mulchen ihre Lebensräume. Dadurch wird das gesamte Ökosystem geschwächt, da diese Insekten wichtige Bestäuber und Nahrungsquelle für andere Tiere sind.
Schädigung der Bodenfauna: Die Mulchschicht verändert das Mikroklima im Boden, was Regenwürmer und andere Bodentiere beeinträchtigt. Diese sind jedoch entscheidend für die Bodenstruktur und den Nährstoffkreislauf.
Begünstigung invasiver Arten: Mulchen fördert oft das Wachstum invasiver Pflanzen, die einheimische Arten verdrängen und die Artenvielfalt weiter verringern.
Keine Frage: Für die Golfanlagen bedeutet das Mehrarbeit. Schließlich muss das Schnittgut zuerst abgefahren werden und dann auch noch weiterverwertet werden. Idealerweise, so wie beim Förde Golf-Klub Glücksburg, befindet sich der Abnehmer gleich mit auf dem Gelände. Hier wird der Grasschnitt als Heu für die Galoway-Rinder verwendet, die neben den Spielbahnen auf einem Ausgleichsgelände grasen. Der Golfclub erzeugt etwa 130 bis 140 Ballen Heu pro Jahr, die dann an die 30 Tiere gehen. „Durch die späte Mahd fällt immer wieder Saatgut auf dem Boden und es ist immer eine saubere Fläche, die immer wieder schön blüht“, stellt Head-Greenkeeper Frank Hansen fest. Eine Win-Win-Situation für den Golfclub, den Herdenbetreiber und die Insekten auf der Golfanlage.
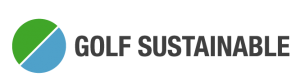






 Foto: Rony Michaud Pixabay
Foto: Rony Michaud Pixabay Fotos: Böhmer
Fotos: Böhmer