Zwei Menschen, ein Ziel: Olaf Gühring und Dagmar Blacha wollen die Artenvielfalt auf einem oberbayerischen Golfplatz steigern. Der Bergkramerhof, so der Name des Golfplatzes im Münchener Süden, gehört der Familie Gühring. Dagmar Blacha ist als Expertin des Landesbund für Vogelschutz auf Golfplätzen eingesetzt, um mit den Verantwortlichen dort Projekte zu entwickeln, die für mehr Artenvielfalt auf der gesamten Fläche sorgen. Das Projekt, in dem Gühring und Blacha gemeinsam aktiv sind, ist der Blühpakt Bayern, den der Bayerische Golfverband und das Bayerische Umweltministerium 2020 abschlossen und 2023 verlängerten.
Das Ziel eint die beiden also, ihr Engagement auch, aber die Ausgangspositionen sind doch völlig andere, wie man an diesem Tag schnell erkennen kann. Für Blacha, die Naturschutzexpertin, sind vor allem die Ausgleichsflächen auf dem rund 80 Hektar großen, leicht hügeligen Gelände interessant. Hecken und Waldbereiche finden sich dort, Kleingewässer, Streuobstwiesen und reine Wiesen.
Für Gühring ist all‘ das zuerst einmal Kulisse. Der reine Golfbetrieb findet auf Fairways, Tees und Grüns statt, deren Pflege bestimmt den Tagesablauf des Greenkeepings. Für Blacha ist dies artenarmes kurzgemähtes Gras. Uninteressant – zumindest auf den ersten Blick.
INSERT_STEADY_NEWSLETTER_SIGNUP_HERE
Im Rahmen der nächsten vier Stunden wird sich der Blick auf diese Spielflächen verändern. „Wir pflegen komplett ohne Pflanzenschutzmittel“, erklärt Gühring. „Geht denn das überhaupt?“ lautet die erstaunte Frage von Blacha, die bereits zahlreiche Besuche bei anderen Golfplätzen hinter sich hat. Sie weiß vom geringen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auf bayerischen Golfplätzen, einen kompletten Verzicht hielt sie bis dato für unmöglich. „Es ist aufwändiger, auch teurer, aber es funktioniert“, klärt Gühring sie auf und zeigt auf seine erstklassig gepflegten Spielbahnen. Gerade der Umgang zum Beispiel mit Pilzkrankheiten auf den Grüns erfordere aber viel Expertise und vor allem den schnellen Einstieg einer Behandlung.
Der Klimawandel mit Feuchtigkeit und höheren Temperaturen fordert den Golfplatzbetreiber, aber genauso auch sein Gegenüber vom Landesbund für Vogelschutz. „In diesem Jahr war die Natur fast drei Wochen früher dran und generell wir haben mehr mit invasiven Arten zu kämpfen“, lautet Blachas Bilanz.
Egal ob Großer Bärenklau, Jakobskreuzkraut oder Drüsiges Springkraut – ihr Vorkommen führt zu einem Verdrängen heimischer Arten. Mit Blick auf die großen Wiesenflächen des Bergrkamerhofes stellt Blacha allerdings erst einmal fest: Der Bestand sieht gut aus. Die Mahd, die hier ein Landwirt vorschriftsmäßig nur zweimal im Jahr vornimmt, passt. Auch die Tatsache, dass am Bergkramerhof ein Großteil der Wiesenflächen als Biotop ausgewiesen und damit nicht betreten werden darf, ist aus Naturschutzsicht positiv. „Aber der Golfer versucht es immer wieder“, erklärt Gühring mit einem Lachen. „Einen Ball gibt man eben nicht gerne verloren.“
Die hohe Kunst der Wiesenpflege, so lernt Gühring an diesem Vormittag von seinem Gegenüber, setzt sich aus mehreren Schritten zusammen. „Je kleinteiliger gepflegt wird, desto besser“, lautet Blachas Devise. „Wichtig ist, dass nie alles auf einmal abgemäht wird, sondern immer Flächen stehen bleiben, in die Insekten und Kleinlebewesen im Falle der Mahd übersiedeln können. Im Winter müssen unbedingt ungemähte Flächen belassen werden, im Idealfall 20 Prozent.“ Für die Mahd selbst empfiehlt sie einen Balkenmäher.
Verkauf des Heus an Pferdehof
Der GC Bergkramerhof verarbeitet das Mahdgut der Wiesen zu Pferdeheu. „Aufgrund der Tatsache, dass wir den Golfplatz ohne Pflanzenschutzmittel pflegen, ist es sehr begehrt“, resümiert Gühring. Über 200 Ballen Heu produziert man pro Jahr, die man an einen Pferdehof verkaufen kann. Ein Ausnahmefall, wie Blacha weiß. Bei zahlreichen Golfanlagen werden Abnehmer für das Mahdgut dringend gesucht.
Einen kritischen Blick wirft die LBV-Expertin auf die Begrünung der verschiedenen Wasserflächen. Das Urteil fällt positiv auf, schon am ersten Teich entdeckt sie mehrere Iris Sibirica die auf der Roten Liste der gefährdeten Arten stehen. Für den Besitzer des Golfplatzes eine positive Erkenntnis. Ja, die Pflanzen waren wegen ihrer auffallenden Blüten ein Hingucker, dass sie eine Rarität sind, war ihm nicht bekannt.
Der gemeinsame Tag ist geprägt vom gemeinsamen Lernen. Dagmar Blacha nimmt von jedem Golfplatz-Besuch ein Stück mehr Wissen über den Betrieb von Golfanlagen mit. „Inzwischen“, so resümiert sie, „weiß ich auch, dass viele Golfclubs alles andere als super ausgestattet sind, wenn es um die Finanzen geht.“ Das Image vom wohlhabenden Golfclub hat sich mit der Zeit verflüchtigt. „Wir wollen ja etwas für die Natur machen, weil das Thema Nachhaltigkeit das Leitbild unseres kompletten Golfplatzbetriebes ist“, stellt Gühring fest. „Aber die wenigsten Golfer werden deshalb hier Mitglied, die wollen zuerst einmal Golf spielen.“
Es geht also darum, Kompromisse zu finden, die das Golfspiel nicht beeinträchtigen, gleichzeitig aber die Natur aufwerten. Eine Rohbodenfläche hätte Blacha zum Beispiel gerne noch, stellt sie zum Ende ihres Besuches fest und erklärt, warum gerade diese so attraktiv zum Beispiel für Wildbienen ist: „Um die Honigbiene müssen wir uns nicht sorgen, um die Wildbienen schon.“ Eine Fläche dafür hat Gühring bereits im Kopf. Sonnig muss sie sein, nicht im Spiel für die Golfer. Ein Par-3-Loch auf der 18-Löcher-Anlage bietet sich dafür an, weil dessen Hang ideal ausgerichtet ist. „Was wir machen können, versuchen wir ja“, lautet Gührings Bilanz. „Deshalb sind wir ja beim Blühpakt dabei.“
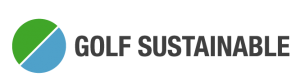






 Foto: Karsten List
Foto: Karsten List Mauritius at Anahita (photo by Four Seasons Hotels Limited)
Mauritius at Anahita (photo by Four Seasons Hotels Limited)