Was passiert, wenn die Verfügbarkeit von Wasser für Golfanlagen weiter sinkt? Sei es, weil Behörden die Grundwasser-Mengen, die Golfanlagen entnehmen dürfen, weiter reduzieren, oder der Preis für Wasser so steigt, dass er die Clubbudgets extrem belastet. Inwieweit kann der Verbrauch von Wasser durch den Einsatz von sogenannten Wetting-Agents und/oder mechanische Behandlungen verbessert werden? Welche Einschränkungen in der Platzpflege ergeben sich, wenn mit wiederaufbereitetem Brauchwasser oder leichte salzigem Wasser beregnet wird, wie es in Meeresnähe häufig vorkommt.
Antworten auf diese Fragen versucht das Projekt Fair-Water II zu geben, das in Deutschland von 2024 bis 2026 auf der Anlage des Golf Club St. Dionys in Niedersachsen durchgeführt wird. Fair-Water II ist eine internationale Studie, die vom Norwegischen Institut für Bioökonomie (NIBIO) geleitet wird. Neben dem GC St. Dionys sind die Golfanlagen Hirsala in Finnland, Romerike in Norwegen und Kalundberg in Dänemark involviert, sowie sieben schwedische Kurse, bei denen aber die Untersuchung mit dem Brauchwasser im Vordergrund steht.
Testflächen mit Wetting-Agents und mechanischer Bearbeitung
Für Christian Steinhauser, Headgreenkeeper des GC St. Dionys und Präsidiumsmitglied des Deutschen Greenkeeper Verbandes, ist die Teilnahme an solchen wissenschaftlichen Projekten unverzichtbar. Er ist am Projekt 1 beteiligt, das sich um die Filzkontrolle im Rasen, die Kombination von Wetting-Agents und mechanische Maßnahmen kümmer. Mit Blick auf den trockenen, sandigen Boden, der Ende April 2025 gerade unter fehlenden Niederschlägen im norddeutschen Raum leidet, stellt er fest: „Ich habe noch nie so früh die Fairwayberegnung benützt wie in diesem Jahr. Der Preis für das Wasser, das wir aus einem Brunnen beziehen, ist 18 mal höher geworden.“ Als Head-Greenkeeper braucht er fundierte Antworten auf die Fragen, wie er in Zukunft noch stärker Wasser sparen kann als er es ohnehin tut.
INSERT_STEADY_NEWSLETTER_SIGNUP_HERE
Aufschluss darüber sollen die Tests geben, die derzeit auf Bahn Neun der Traditions-Golfanlage nahe Hamburg durchgeführt werden. Hier hat Steinhauser neun Parzellen mit jeweils einer Fläche von zwölf mal acht Metern gekennzeichnet, deren Gräser und Bodenbeschaffenheit im vergangenen Jahr genau analysiert wurden. „Der Filz an der Oberfläche sorgt leider dafür, dass das Wasser im Boden nicht optimal verteilt wird“, resümiert Steinhauser.
Deshalb wird auf Teilen der Flächen, die im vergangenen Jahr durch Vertikutierung und Tiefenlüftung bearbeitet wurden, nun der Einsatz von Bodenbenetzungsmitteln, sogenannten Wetting Agents erprobt. Diese sorgen laut Angaben der Hersteller dafür, dass Pflanzen und Boden die Feuchtigkeit besser speichern können. Zwei Fabrikate werden getestet, sie werden von April bis September monatlich auf der Fläche angewendet.
Keine Fairwayberegnung
Die Fairwayberegnung hat Steinhauser auf den Testflächen der Spielbahn ausgeschaltet. Auskommen müssen die Gräser nun mit Regenwasser. Mit Verweis auf andere Golfanlagen, vor allem auf den Britischen Inseln, zum Teil aber auch bereits in Deutschland, resümiert der Rasenexperte: „Wir wissen, dass die Spielbarkeit auch bei brauner Farbe gegeben ist. Die Frage ist allerdings, ob der Golfer das hier bereits akzeptiert.“
Bereits vor dem Start von Fair-Water II hat Steinhauser mit der Nachsaat von Festuca-Gräsern auf den Fairways dafür gesorgt, dass der Wasserverbrauch des Golfplatzes sinkt. Auch durch einen deutlich geringeren Einsatz von Dünger ist das Wachstum des Grases verringert. Jetzt kommt einerseits der Verzicht auf die Fairwayberegnung dazu. Andererseits könnten die Wetting Agents und die mechanische Bodenbehandlung positiv wirken.
„Mit einer Bodenstruktur, die zu 97 Prozent aus Sand und Kies besteht, ist dieses Fairway in St. Dionys sehr empfindlich gegen Dürre“, analysiert Steinhauser den Bestand. Die Rasenfilzschicht von 33 Millimeter mit einem Anteil von 29 Prozent organischer Substanz mache außerdem deutlich, dass hier Rasenfilzkontrolle nötig sei.
Bereits im April 2025 wird klar, dass sich die Optik des Golfplatzes bei einer Pflege, wie Fair-Water II sie vorsieht, verändert: Das Testgelände ist eher hellgrün, der Boden hart, das Gelände als Spielfläche aber durchaus gut geeignet. Der Ball der Spieler kann auf dem harten Boden länger laufen.
Ein Ergebnis der Studie ist derzeit noch nicht abzusehen. Das Prozedere der mechanischen Bearbeitung wird sich im Herbst 2025 noch einmal wiederholen, der Einsatz von Wetting Agents 2026 fortgesetzt. Wer schnelle Ergebnisse erwartet, wird enttäuscht. Fair-Water II ist ein wissenschaftliches Projekt, das am Ende auch konkrete Ergebnisse darüber liefern wird, ob der Einsatz der Wetting-Agents Sinn macht, die vergleichsweise teuer sind. „Aber wer weiß, wenn das Wasser noch teurer ist als die Wetting-Agents macht die Ausgabe dann womöglich Sinn“, überlegt Steinhauser.
Eines jedenfalls steht für ihn jetzt schon fest: die Zukunft des Golfsports hängt von der Verfügbarkeit von Wasser ab. Und die wird geringer.
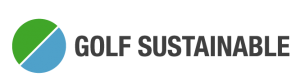






 Foto: Envato
Foto: Envato