Welchen Kühlungseffekt haben Grünflächen während Hitzewellen? Die im August 2025 veröffentlichte Studie „The cooling effect of urban green spaces as nature-based solutions for mitigating urban heat: insights from a decade-long systematic review“ zeigt, wie effektiv Urban Green Spaces (UGS) als Nature-Based Solutions (NBS) zur Minderung des Urban Heat Island (UHI) wirken. Basierend auf der Analyse von 84 wissenschaftlichen Studien der letzten zehn Jahre belegt die Untersuchung, dass gut geplante und gepflegte Grünflächen Temperaturen in Städten um bis zu 7 °C senken können. Diese Studie ist damit auch für Golfanlagen relevant, die sich in stadtnahen Gebieten befinden und aus den Ergebnissen wichtige Erkenntnisse für die Strukturierung ihrer Flächen ziehen können.
Ausgangslage: Der wachsende Urban Heat Island Effekt in Städten weltweit
Mit dem globalen Städtewachstum – schon heute leben über 56 % der Weltbevölkerung in urbanen Gebieten – nimmt die Hitzebelastung dramatisch zu. Versiegelte Flächen aus Asphalt und Beton speichern Wärme, blockieren Verdunstung und fördern die Erhitzung. Besonders in heißen und trockenen Klimazonen verschärfen Wasserknappheit und fehlende Vegetation das Problem. Die Folge: mehr Hitzetage, steigender Energieverbrauch für Klimaanlagen und wachsende Gesundheitsrisiken.
Nature-Based Solutions in Europa: Klimaanpassung mit Urban Green Spaces
Die Europäische Kommission setzt zunehmend auf Nature-Based Solutions, um Klimarisiken zu mindern und Städte klimaresilienter zu gestalten. Urban Green Spaces – von Stadtparks über Baumalleen bis zu grünen Dächern – sind dabei ein zentrales Element. Sie senken nicht nur Temperaturen, sondern verbessern auch Luftqualität, Biodiversität und Lebensqualität. Die Studie zeigt: Urbanes Grün ist ein unverzichtbares Werkzeug moderner Klimaanpassung
Welche Flächen wurden untersucht – und welche nicht?
Die analysierten Studien konzentrierten sich auf eine breite Palette urbaner Grünstrukturen: große Stadtparks, Straßenbäume, kleinere Pocket Parks, begrünte Plätze, Mischflächen aus Gras und Sträuchern sowie innovative Lösungen wie grüne Dächer und vertikale Begrünung.
Nicht Teil der untersuchten Flächen waren Golfanlagen oder andere großflächige Freizeitareale. Die Ergebnisse lassen sich daher nicht direkt auf diese Flächentypen übertragen, auch wenn ähnliche Kühlmechanismen dort theoretisch wirksam sein könnten. Ein Manko, das sich vor allem auf die Golfplätze auswirkt, die hier ein wichtiges Argument für ihr Bestehen an der Hand haben könnten. Schließlich gibt es gerade in Großstädten immer wieder die Forderung, Golfplätze zu schließen und für Wohnbebauung zu nutzen.
INSERT_STEADY_NEWSLETTER_SIGNUP_HERE
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Golfanlagen
Golfanlagen unterscheiden sich in mehrfacher Hinsicht von den in der Studie untersuchten Urban Green Spaces. Sie sind in der Regel großflächiger, weisen einen hohen Anteil an offenen Rasenflächen auf und verfügen oft über eingestreute Baumgruppen, Gewässer und Strauchbereiche.
- Kühlmechanismen wie Beschatten wirken auf Golfplätzen primär dort, wo Bäume und Strauchzonen Schatten spenden – großflächige Fairways hingegen bieten kaum Beschattung.
- Die Evapotranspiration kann auf Golfanlagen durch die extensive Rasenbewässerung sehr hoch sein, was zu deutlicher lokaler Abkühlung führen kann. Allerdings ist dieser Effekt stark von der Wasserverfügbarkeit und der Intensität der Bewässerung abhängig.
- Räumliche Anordnung: Da Golfplätze in der Regel nicht mitten in dicht bebauten Innenstadtgebieten liegen, ist ihr Beitrag zur Abmilderung des Urban Heat Island im Stadtzentrum geringer. Dennoch können sie für das lokale Mikroklima im Umfeld relevant sein, insbesondere wenn sie an Wohngebiete angrenzen.
Golfanlagen können also ähnliche Kühlungseffekte erzeugen wie städtische Grünflächen, insbesondere durch gezielte Baumpflanzungen und Wasserflächen. Allerdings unterscheiden sich die Rahmenbedingungen deutlich, sodass die Ergebnisse der Studie nur bedingt übertragbar sind.
Die drei Hauptmechanismen des Kühlungseffektes
Die Metastudie identifiziert drei Hauptmechanismen, die den Kühlungseffekt von Urban Green Spaces bestimmen:
- Beschattung
Bäume mit dichten Kronen blockieren direkte Sonneneinstrahlung, reduzieren Oberflächentemperaturen um bis zu 16 °C und sorgen lokal für 2–7 °C kühlere Luft. Dabei spielen die Kronendichte, Baumhöhe und Artenwahl eine wichtige Rolle– immergrüne Bäume bieten ganzjährigen Schutz, Laubbäume saisonale Spitzenkühlung. - Evapotranspiration
Pflanzen kühlen durch Wasserabgabe über Blätter. Dieser Prozess kann Lufttemperaturen um 1–5 °C senken. Breite Blätter, hohe Blattdichte und gezielte Bewässerung steigern den Effekt. In sehr trockenen Klimazonen ist die Leistung ohne Bewässerung jedoch begrenzt. - Optimale räumliche Anordnung
Vernetzte Grünflächen, lineare Parks und grüne Korridore leiten Kaltluft tiefer ins Stadtgebiet. Große, zusammenhängende Parks wirken bis zu 500 m in die Umgebung hinein.
Was den Kühlungseffekt schwächt
Wasserknappheit und fehlende Bewässerung behindern den Kühlungsprozess allerdings genauso wie die Auswahl falscher Pflanzenarten mit geringer Blattfläche oder niedriger Verdunstungsrate. Außerdem dürften die Grünflächen nicht zu klein sein und zu gestückelt. Hier spiegelt die Vernetzung der Flächen eine Rolle, auch das ist ein Argument für Golfplätze, die in der Regel Grünflächen auf mindestens 50 Hektar bei 18 Löchern bieten.
Die besondere Rolle der Pflanzen im Kühlprozess
Bäume sind die unangefochtenen Stars unter den Nature-Based Cooling Solutions: Sie kombinieren großflächige Beschattung mit hoher Verdunstungsleistung. Mischpflanzungen aus Bäumen, Sträuchern und Gräsern maximieren den Effekt. Artenvielfalt erhöht zudem die Widerstandsfähigkeit gegen Klimastress und sorgt für ganzjährige Kühlwirkung.
Das bedeutet für die Betreiber von Golfanlagen aber auch einen schwierigen Abwägungsprozess. Schließlich benötigen Bäume Wasser und gerade die Beschattung von Grüns und Abschlägen führt immer wieder zu Pflegeproblemen. Wichtig ist hier also, den richtigen Mix zu finden: Bäume mit wenig Wasserverbrauch und großer Hitzeresistenz sollten gepflanzt werden. Gleichzeitig müssen die Spielbahnen so geplant werden, dass es keine Pflegeprobleme durch Beschattung gibt.
Golfplätze oder Stadtparks?
Unabhängig von der aktuellen Studie haben sich Wissenschaftler in den vergangenen Jahren auch bereits mit den speziellen Kühlungseffekten von Golfplätzen befasst und dabei auch Vergleiche mit Stadtparks angestellt. Letztere wirken demnach meist stärker auf den Kern des Urban Heat Island Effekts, weil sie näher an Hitze-Hotspots liegen und hohe Baumanteile haben.
Golfplätze haben also ein großes Potenzial für Kühlung, insbesondere durch hohe Evapotranspiration bei Bewässerung. Ihre Wirkung auf das städtische Klima hängt jedoch stark von Lage, Vegetationsstruktur und Wasserressourcen ab.
Wer sich näher mit dem Thema befassen will, findet hier eine Literaturliste mit Forschungsergebnissen:
- Abd-Elmabod, S. K., et al. (2024). Seasonal variability of cooling services across urban green land-use types: Comparative assessment with parks, agriculture, and golf courses. Sustainable Cities and Society, 105, 105313. https://doi.org/10.1016/j.scs.2024.105313
- Fung, C. K. W., Jim, C. Y., & Song, C. (2017). Microclimatic effects of a subtropical golf course in an urban heat island. Urban Forestry & Urban Greening, 24, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.03.003
- Hamel, P., et al. (2021). Modeling the impact of land use change on urban ecosystem services: Insights from converting golf courses. npj Urban Sustainability, 1(1), 1–10. https://doi.org/10.1038/s42949-021-00025-8
- Lonsdorf, E., et al. (2021). Relative importance of different green space types for urban heat mitigation: An ecosystem services modeling approach. Landscape and Urban Planning, 209, 104043. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2021.104043
- Nguyen, T. T., et al. (2022). Cooling performance of urban green spaces: A comparative analysis of land cover types in Perth, Australia. Remote Sensing, 14(9), 2094. https://doi.org/10.3390/rs14092094
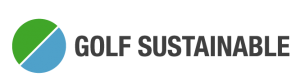



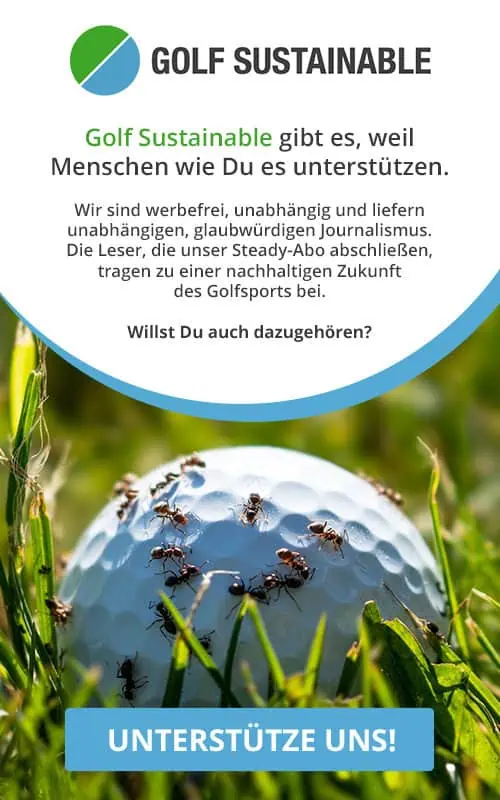




 Mauritius at Anahita (photo by Four Seasons Hotels Limited)
Mauritius at Anahita (photo by Four Seasons Hotels Limited) Anna Lurye / Shutterstock.com
Anna Lurye / Shutterstock.com