Die Welt wird digitaler. International zieht es immer mehr Menschen in die Städte, in Europa leben schon heute über 70 Prozent der Menschen in Städten, in den USA sind es über 80 Prozent. Und immer mehr Eltern stellen sich die Frage, wie sie Kinder und Jugendliche vom übermäßigen Konsum digitaler Inhalte abhalten können, nachdem die Bildschirmzeit seit der Corona-Epedemie in vielen Ländern zugenommen hat.
Sport und Freizeitangebote im Freien gelten dabei als gesunde Alternative, wenn es darum geht, Heranwachsende aus der ständigen digitalen Vernetzung zu lösen. Auch die Betreiber von Golfanlagen könnten gerade in städtischen Regionen diesen Gedanken in positiver Weise für sich nutzen. Nachdem Golfplätze in der Regel neben den reinen Spielbereichen über große zusammenhängende Grünflächen mit ökologischer Vielfalt verfügen, könnten sie auch den Nebeneffekt haben, dass sie damit bei den Spielern für mehr mentale Gesundheit und positive Emotionen sorgen. Alles nach dem Motto: Raus aus der digitalen Welt, rein in die echte Natur.
Report zu Biodiversität und Gesundheit
Der kürzlich im Magazin People and Nature veröffentlichte Forschungsbericht Will biodiversity actions yield healthy places von Erica N. Spotswood und anderen Wissenschaftlern dürfte von Lesern aus der Golfindustrie sehr positiv aufgenommen werden. Er unterstützt nämlich den Argumentationsansatz, dass natürliche Grünflächen in Stadtgebieten gut für die Gesundheit sind. Der Report, der insgesamt 1550 internationale Studien zusammengefasst hat, kommt nämlich zu dem Ergebnis, dass Flächen mit hohem Wert für die Biodiversität auch für die Gesundheit des Menschen förderlich sein können.
Dabei spielen laut den Wissenschaftlern sieben Faktoren bei der Gestaltung der Grünflächen eine wesentliche Rolle. Neben der Größe der Grünfläche, sind vernetzte Lebensräume, die Anlage von biodiversitätsfördernden Elementen, die Verwendung einheimischer Pflanzen sowie besondere Elemente wie Wasserstrukturen oder große Bäume und am Ende das passende Management dieser Flächen entscheidend dafür, dass eine Grünfläche als hochwertig eingeordnet werden.
Golfplätze, die sich dem Thema Ökologie verschrieben haben, werden diesen Vorgaben fast immer gerecht, weil sie neben Wiesen, Hecken, Totholz- und Rohbodenbereichen, Waldstücken oder Teichen eine Vielzahl hochwertiger Lebensräume für Pflanzen und Insekten bieten.
Verbesserte Entwicklung von Kindern
„Die Ergebnisse (der Studie) zeigen, dass viele Elemente, die Biodiversität unterstützen, gleichzeitig mit einer großen Serie von positiven gesundheitlichen Auswirkungen zusammenfallen“, resümieren die Forscher. „Diese Effekte beinhalteten einen besseren körperlichen Zustand und mentale Gesundheit, mehr körperliche Aktivität, eine verbesserte Entwicklung im Kindesalter und soziale Effekte.“ Dazu kommt, dass Menschen von großen Grünflächen in innerstädtischen Bereichen profitieren, weil sie Sonne, Hitze, Luftverschmutzung und Lärm weniger ausgesetzt sind. Die Autoren sprechen zum Beispiel von reduzierten Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder verringerter Diabetes.
Alles bestens also – ist die neue Spotswood-Studie perfekt auf Golfplätze zugeschnitten?
Nicht ganz: Anders als zusammenhängende Parks oder natürliche Wälder, bestehen Golfanlagen ja nicht ausschließlich aus Bereichen, die vor allem die Biodiversität fördern. Fairways, Tees und Greens laufen in der Beurteilung von Wissenschaftler stattdessen genauso wie Fußballplätze oder andere gepflegte Grünflächen unter Nutzrasen. Hier wird die Biodiversität nicht gefördert und vor allem der Einsatz von Pestiziden gilt nicht als gesundheitsfördernd.
Multifunktionale Nutzung von Golfplätzen
Ein negativer Einwand, den man allerdings dadurch deutlich abschwächen kann, dass man Golfanlagen multifunktional nutzt. Dies empfiehlt auch die GEO Foundation in ihren Public Facilities Guidelines für den nachhaltigen Betrieb von öffentlichen Golfanlagen.
Eine solche multifunktionale Nutzung wäre zum Beispiel der Golfplatz als Lernarena. Im Rahmen von sogenannten grünen Klassenzimmern findet der Schulunterricht eben nicht im üblichen Schulgebäude ab, sondern irgendwo auf dem Golfplatzgeländes.
In Schweden hat man diesen Ansatz bereits im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes von STERF untersucht, das den Namen Go outdoors and use the Golf course in an educational way trug. Obwohl die Lehrer dabei am Anfang erst ein wenig Zeit brauchten, um zu erkennen, welche vielfältigen Möglichkeiten des Unterrichts ausgerechnet ein Golfplatz bot, waren die Ergebnisse der Studie am Ende ausgesprochen positiv.
„Ein offeneres Unterrichtsklima“ gehörte ebenso zu den positiven Effekten wie die Entwicklung eines „tieferen Verständnisses und Kontaktes mit den Schülern“. Speziell die Bewegung im Freien und der Ortswechsel sorgten demnach für ein besseres Lerngefühl bei den Schülern, die sich hier wohler fühlten als in den Klassenzimmern. Laut Anders Szczepanski, der die Studie leitete, kann außerdem „hohe biologische Vielfalt mit einem hohen Grad an pädagogischer Vielfalt kombiniert“ werden. Unterricht auf dem Golfplatz führte nach seinen Aussagen keineswegs zu einem schlechteren Lernverlauf.
In Deutschland werden im Rahmen des Projektes Golf Biodivers, bei dem sich vier Universitäten mit dem Thema Biodiversität auf Golfplätzen befassen, Unterrichtseinheiten auf Golfanlagen verlegt. Die Bilanz der Lehrer ist dabei durchweg positiv, was die Aufmerksamkeit der Schüler betrifft. Swiss Golf bietet Golfanlagen, die interessiert sind, spezielle Biodiversitäts-Tage für Kinder an.
Der Wert von Golfplätzen besteht also nicht allein darin, dass sie eine reine Sportfläche bieten. Ganz im Gegenteil: Die Roughflächen um die Fairways herum, die Wiesen, Waldbereiche, Teiche und Hecken, die ohnehin die Biodiversität in städtischen Bereichen steigern, können durch eine Zweitnutzung für Nicht-Golfer zusätzliche positive Effekte erzielen. Sei es, weil sie mit Spazier- und Radwegen, Picknickstellen oder Aussichtspunkten für Naturbeobachtungen für mehr Lebensqualität, mentale und körperliche Gesundheit all jener sorgen, die dieses Angebot nutzen. Sei es, weil sie dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche positive Impulse für ihre persönliche Entwicklung bekommen.
Getrennt vom Netz und verbunden mit der Natur – ein Erfolgsmodell, das Golfplätze mit viel Biodiversität möglich machen.
INSERT_STEADY_NEWSLETTER_SIGNUP_HERE
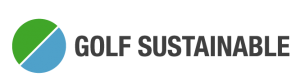






 fotos: Petra Himmel, Golf de Chantilly
fotos: Petra Himmel, Golf de Chantilly Thank you for your support
Thank you for your support