Biodiversitäts-Lexikon: A wie Artenvielfalt
Im Golfsport sprechen wir immer wieder von der Förderung der Artenvielfalt. Dabei wird in der Regel hauptsächlich an Vögel, Schmetterlinge oder gut sichtbare Tiere auf Golfanlagen gedacht, sei es der Fuchs, der Hase oder das Reh. Gemeint ist tatsächlich mit dem Begriff aber die komplette Vielfalt der verschiedenen Tier-, Pflanzen- und Mikroorganismenarten in einem bestimmten Gebiet.
Unser Titelbild zeigt das Rough auf dem Golfplatz von Royal Dornoch in Schottland. Der Blick auf die unterschiedlichen Grüntöne beweist: Allein die Anzahl an Kräutern, Gräsern und Flechten ist enorm. Dazu kommen dann noch unzählige Mikroorganismen im Boden.
Ein weiteres anschauliches Beispiel sind die Totholzhaufen, die inzwischen auf zahlreichen Golfplätzen jenseits der Spielbahnen an geeigneten Stellen aufgestellt werden. Forst-Wissenschaftler schätzen, dass zum Beispiel in Deutschland über 8.000 Pflanzen, Tiere und Pilze auf Totholz angewiesen sind. Baummarder, Siebenschläfer, Spechte, Eulen und Fledermäuse leben in den Höhlen und Taschen der Rinde von Totholz. Andere Arten nutzen Totholz als „Kinderstube“– beispielsweise die Larven des Hirschkäfers. Außerdem leben viele Insekten, Spinnen, Moose und Flechten in Totholz. Außerdem sorgen unzählige Mikroorganismen dafür, dass das Totholz verfällt. Die Artenvielfalt ist also enorm.
Dabei baut die Nahrungskette der verschiedenen Arten aufeinander auf. Je höher die Artenvielfalt ist, desto mehr Arten können voneinander und miteinander bestehen. Je mehr Arten in einem bestimmten Lebensraum ausfallen, desto schwieriger wird das Überleben für die nächste Art.
INSERT_STEADY_NEWSLETTER_SIGNUP_HERE
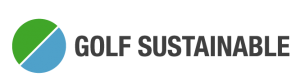

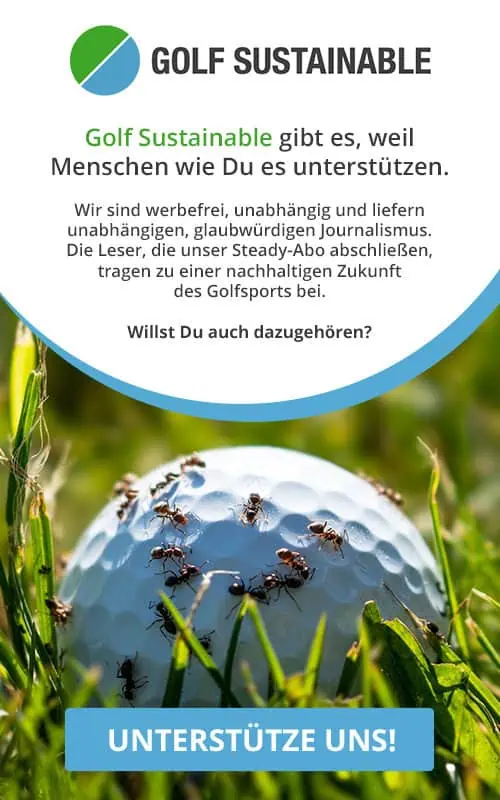




 Fotos: GCSAA/Petra Himmel
Fotos: GCSAA/Petra Himmel Fotos: Petra Himmel/Shutterstock
Fotos: Petra Himmel/Shutterstock