Biodiversität: Symposium von R&A und FFGolf definiert neue Ziele
Was passiert, wenn sich ein Golfverband beim Thema Biodiversität der Analyse von außen stellt? Das „Das war nicht einfach für sie und das war nicht einfach für uns“, beantwortet Pascal Grizot, der Präsident des Französischen Golfverbandes diese Frage mit Blick auf die Kooperation des Verbandes mit dem Nationalen Museum für Naturgeschichte in Frankreich. Bei der ersten Biodiversitäts-Konferenz des Verbandes und des R&A in Paris wurde klar: Das im Golfsport dominierende Nachhaltigkeits-Thema Biodiversität wird in seiner Komplexität erst erkennbar, wenn es von Wissenschaftlern, Naturschutzorganisationen und Daten-Experten unter die Lupe genommen wird. Das fordert die Golfbranche, die stets betont, dass Golfplätze gut für die Artenvielfalt seien, dies aber bis dato in den seltensten Fällen wissenschaftlich belegen kann.
Französischer Golfverband setzt Maßstäbe
Im Französischen Golfverband hat man dies die vergangenen sieben Jahre getan. „Wenn man als Institution anerkannt werden will und glaubwürdig sein will“ sei eine Zertifizierung durch Experten, die außerhalb der Golfbranche stehen, unerlässlich, erklärte Grizot die Gründe des Verbandes mit dem Nationalen Museum für Naturgeschichte zusammenzuarbeiten.
Einfach sind solche Kollaborationen demnach nicht. Laut Grizot bewirken sie aber auf beiden Seiten einen notwendigen Lernprozess. „Wir brauchen glaubwürdige und verlässliche Daten für eine Aussage zu einem Projekt“, machte Laurent Poncet, Direktor von PatriNat klar, das im Rahmen der Datenerhebung ebenfalls in die Zertifizierung der französischen Anlagen involviert ist. 67.000 Daten zu gefundenen Pflanzen, Tieren oder Insekten in insgesamt mehr als 16.100 Lebensräumen über die bis dato 216 beteiligten französischen Golfplätze hat man bis dato angelegt. Daraus, so Poncet, lassen sich inzwischen allgemeine Schlüsse über Veränderungen der Artenvielfalt von Golfplätzen je nach Umgebung, Klima oder Management ziehen. Letztendlich ermöglicht dies auch die Einführung eines strukturierten Managements der Lebensräume auf dem Golfplatz.
Newsletter abonnieren!
News & Trends rund um das Thema Nachhaltigkeit im Golfsport
Golfplätze nämlich führen nicht automatisch zu einer Förderung der Artenvielfalt. „Golfplätze können gut sein für die Biodiversität“, betonte auch Marie Athorn, die im Auftrag des R&A für die größte britische Naturschutzorganisation RSPB die Beratung auf Golfplätzen in Großbritannien übernimmt.
Hochqualitative Landschaften und Naturräume zu schaffen, wird jetzt als neues Ziel der Golfbranche definiert. „Wir müssen die Natur durch den Golfsport bewahren und wiederherstellen“, forderte Phil Anderton als CDO des R&A. „Das wird am Ende auch zu einem besseren Golfsport führen.“ Dazu werde man die Erkenntnisse aus der Arbeit des französischen Golfverbandes mit dem Nationalen Museum für Naturgeschichte auf andere Verbände übertragen.
Erste Projektgruppen gestartet
Damit begonnen wurde bereits am Tag nach der Konferenz: In unterschiedlichsten Workshops fanden sich die Vertreter zahlreicher Golfverbände, von Universitäten und Naturschutzorganisationen zusammen, um Ziele, Maßnahmen und Projekte zu formulieren.
Dabei könnte für den Golfsport in Zukunft vor allem das Zusammenspiel von Natur und Gesundheit wesentlich sein. Andrew Murray als Arzt und Alice Fouillouze von der Universität Lille verdeutlichten, dass nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale Gesundheit von einer stärkeren Verbindung des Menschen mit der Natur profitiert.
Wie aber gewinnt man den Golfer für das Thema? Kommunikation als Schlüssel zur Transformation stellt die Golfbranche vor Herausforderungen. Einmal abgesehen von der reinen Kommunikation im Club, sind es im Sport generell Spitzensportler und Großveranstaltungen, die das Thema promoten können. Wie sehr der Verzicht auf Gewohntes, die Abkehr von bisherigen Qualitätsdefinitionen dabei zu einem Ringen werden kann, erklärte Paul Armitage am Beispiel des Golfwettbewerbs der Olympischen Spiele in Paris, für dessen Organisation er mitverantwortlich war. Der Druck, eine nachhaltige Veranstaltung abliefern zu müssen, habe bei sämtlichen Golfverantwortlichen „definitiv zu einer Veränderung unseres Verhaltens geführt.“
Golf öffnet sich für Beurteilung von Außen
Zumindest an diesem Tag und bei dieser Konferenz herrschte Einigkeit bei den Anwesenden, was die Bedeutung des Themas Biodiversität für den Golfsport bedeutet. „Wir haben zum ersten Mal bei so einer Veranstaltung auch Nicht-Golf-Organisationen dazugeholt“, das verbuchte John Kemp als Projektmanager des R&A als wirklichen Erfolg. Jetzt sei es allerdings an der Zeit, die Erkenntnisse auch wirklich in Taten umzuwandeln. Wie aufwändig, das in der Detailplanung werden kann, ließ sich anhand der Projektbeschreibungen von Sylvianne Villaudière, Vizepräsidentin des Französischen Golfverbandes leicht verfolgen. Sie hat für das Jahr 2025 zum Beispiel mit ihrem Team erstmalig Offene Tage der Biodiversität auf französischen Golfanlagen initiiert, um sowohl Golfern wie Nicht-Golfer das Thema Natur auf Golfanlagen besser zu vermitteln.
Zurücklehnen kann sich die Golfbranche auch beim Thema Biodiversität offensichtlich nicht. Leidenschaftlich und warnend rückte Gilles Boeuf als Ex-Präsident des Nationalen Museums für Naturgeschichte die Selbsteinschätzung des Auditoriums zurecht. „Lasst uns nicht arrogant sein“, lautete seine Botschaft. Wer seine Umwelt nicht im Auge behalte, gefährde sich selbst. „Am Ende sind auch wir hauptsächlich Wasser und Mikroorganismen.“
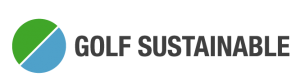


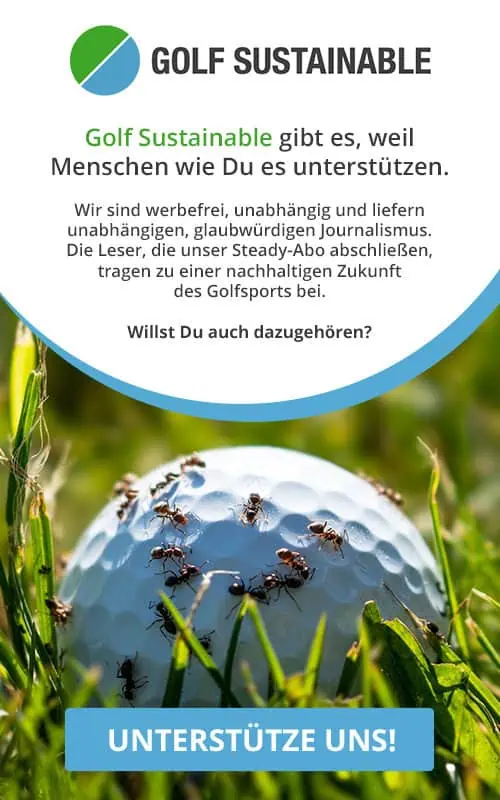




 Foto: USGA
Foto: USGA Fotos: GCSAA/Petra Himmel
Fotos: GCSAA/Petra Himmel